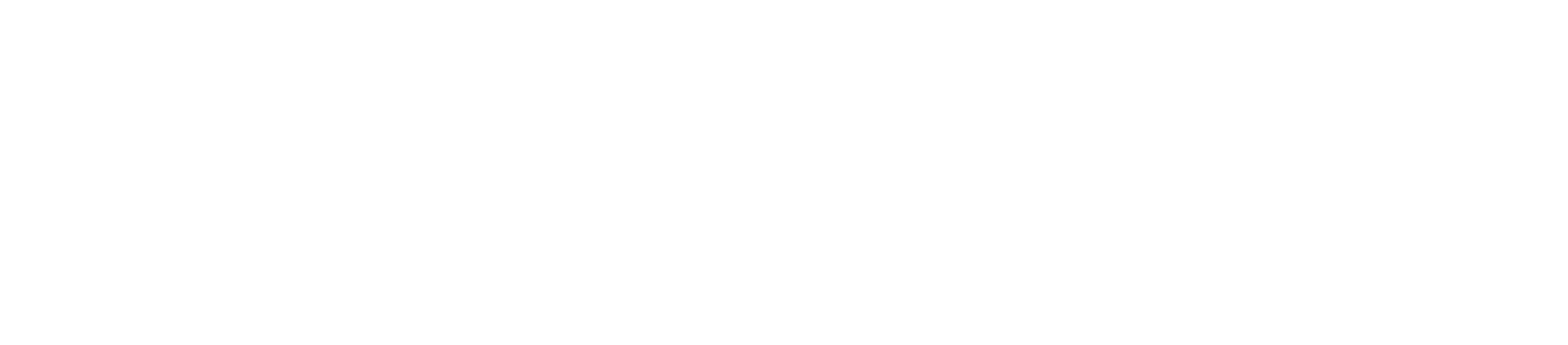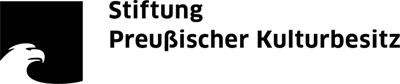SIM-Jahrbuch ab sofort frei zugänglich!
News vom 21.03.2025
Das Jahrbuch des SIM steht ab dem Jahrgang 2020/2021 als digitale Open-Access-Publikation bei musiconn.publish zur Verfügung. Die Qualitätssicherung erfolgt durch ein Peer-Review-Verfahren.

Das Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung (SIM) bietet ein weit gefächertes Spektrum, das in erster Linie die wissenschaftliche Arbeit des Instituts in den Bereichen Musikgeschichte, Instrumentenkunde und systematische Musikwissenschaft widerspiegelt. Darüber hinaus ist es ein Forum für aktuelle Forschungsfragen aus verschiedenen musikwissenschaftlichen Richtungen.
Nachdem das SIM-Jahrbuch zunächst bei de Gruyter (die Jahrgänge 1968 und 1969), später bei Merseburger (bis 1987/1988) sowie Metzler (bis 2004) und zuletzt bei Schott erschienen war, steht es ab dem Jahrgang 2020/2021 bei musiconn.publish zur Verfügung als ausschließlich digitale Open-Access-Publikation. Die Qualitätssicherung des Jahrbuchs erfolgt ab dem Jahrgang 2020/21 durch ein Peer-Review-Verfahren.
Die ersten beiden verfügbaren Jahrbücher dokumentieren Symposien, die am Staatlichen Institut für Musikforschung stattgefunden haben.
Das Jahrbuch 2020/21 präsentiert Beiträge zum Symposium »Blechblasinstrumente im 19. und frühen 20. Jahrhundert«, das die Sonderausstellung »Valve. Brass. Music. 200 Jahre Ventilblasinstrumente« im Musikinstrumenten-Museum des SIM begleitete.
Die von den beiden Musikern Heinrich Stölzel (1777–1844) und Friedrich Blühmel (1777–1845) ausgehende Erfindung von Ventilen an Metallblasinstrumenten war eine Revolution im Musikinstrumentenbau, vergleichbar mit der Erfindung des Hammerklaviers kurz vor 1700, der Erfindung der Klarinette um 1705 oder auch des Trautoniums 1930 und der Hammond-Orgel 1933/34. Denn erst die Ventilblasinstrumente ermöglichten Musikstücke für Metallblasinstrumente nahezu ohne tonale und technische Einschränkungen. Ausgehend vom Waldhorn wurden Ventile bereits ab 1818 auf andere Metallblasinstrumente wie Trompeten und Posaunen übertragen. Diese ersten Ventilformen waren keineswegs perfekt, wurden ständig verbessert und durch weitere Innovationen ergänzt. Sabine K. Klaus greift diese Entwicklungen auf und erläutert in ihrem Beitrag die deutschen Wurzeln in den Ventilkonstruktionen von Adolphe Sax. Aufgrund der klanglichen Unausgewogenheit der ersten Ventile fanden diese trotz ihrer revolutionären Vorteile zunächst keine uneingeschränkte Zustimmung. Am Beispiel der Hoforchester von Weimar und Dresden zeigt Christian Ahrens auf, mit welchen Schwierigkeiten die Hersteller von Ventilhörnern und Ventiltrompeten bei der Einführung der neuen Instrumente zu kämpfen hatten. Enrico Weller wiederum gibt Einblicke, wie die neue Erfindung auf Seiten der Hersteller aufgegriffen wurde. Am Beispiel Markneukirchens, das bis heute ein Zentrum des Metallblasinstrumentenbaus ist, konzentriert er sich auf die Fertigung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Arnold Myers widmet sich in seinem Aufsatz der Frage, wie das bereits bestehende Instrument (Klappen-)Ophikleide auf das neue System der Ventile umgerüstet wurde und Bruno Kampmann fasst in seinem Artikel die Ergebnisse seiner Forschungen zu einer Systematik der Ventile für Metallblasinstrumente zusammen, die er anhand zahlreicher Instrumente seiner eigenen Sammlung erstellt hat. Damit bietet er eine umfangreiche Klassifikation, die vor allem für Dokumentation und Vergleich von Ventilblasinstrumenten von hohem Wert ist.
Ergänzt werden die Beiträge zum Symposium durch einen Text zur Berliner Musikgeschichte, einem traditionellen Themenschwerpunkt des Jahrbuchs. Wilhelm Poeschel beleuchtet die Tätigkeit des Kantors Rudolph Dietrich Buchholtz an der Berliner Petri-Kirche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Zum 100. Geburtstag des Komponisten György Ligeti fand 2023 am SIM ein Symposium zum Thema »Ligeti – Raum | Interpretation« statt, dessen Beiträge im Jahrbuch 2023 veröffentlicht werden.
›Raum‹ und ›Interpretation‹ sind für Ligetis Musik von weitreichender Bedeutung, und zwar sowohl als kompositorische wie als aufführungspraktische Kategorien. Von den im Jahrbuch veröffentlichten zwölf Texten sind vier dem Thema Raum gewidmet, acht der Interpretation. Christian Utz und Amy Bauer befassen sich ebenso mit Ligetis theoretischen Äußerungen zum Raum wie mit seinen künstlerischen Realisierungen. Emmanouil Vlitakis und Ullrich Scheideler präzisieren Ligetis Raumbegriff und analysieren detailliert, wie Ligeti in einzelnen Kompositionen mit räumlichen bzw. raum-zeitlichen Assoziationen spielt.
Von den der Interpretation gewidmeten Aufsätzen sind die ersten beiden grundsätzlicher Natur. Ulrich Mosch geht vor dem Hintergrund eines Textes des Soziologen Alfred Schütz aus den 50er Jahren der Frage nach, ob man bei der Aufführung Ligeti’scher Musik eigentlich von Interpretation sprechen kann und inwieweit es für das Gelingen der Interpretationen Bewertungsmaßstäbe gibt. Florian Besthorn, der den Einfluss der Kompositionen Conlon Nancarrows auf das Schaffen Ligetis diskutiert, erhellt im Zusammenhang mit der Analyse der Übertragung zweier Klavieretüden auf das Playerpiano durch Ligeti dessen Begriff einer »lebendigen Interpretation«. In nicht weniger als fünf Texten wird die Zusammenarbeit zwischen Ligeti und seinen Interpreten bzw. Interpretinnen thematisiert, deren genaue Betrachtung zum Verständnis der Interpretationen ebenso beitragen wie zu dem der Werke selbst: die Zusammenarbeit mit Pierre-Laurent Aimard und Erika Haase an Werken der Klaviermusik (Tobias Bleek, Volker Rülke), mit Gerd Zacher, Gabor Lehotka und Karl-Erik Welin an den Werken für Orgel (Markus Rathey); mit Eric Ericson am Requiem (Michael Kube) sowie mit Friedrich und Gertraud Cerha und dem Ensemble die reihe an Aventures und dem Kammerkonzert (Gundula Wilscher). Heinz von Loesch befasst sich auf der Grundlage von CD- und Videoaufnahmen mit der Interpretationsgeschichte des Cellokonzerts über einen Zeitraum von gut 50 Jahren, wobei softwaregestützte Messungen das Close listening/viewing ergänzen.
Das neue, international besetzte Editorial Board des Jahrbuchs besteht aus Wolfgang Fuhrmann (Universität Leipzig), Sabine K. Klaus (University of South Dakota, University of Edinburgh), Natasha Loges (Hochschule für Musik Freiburg), Christoph Neidhöfer (McGill University, Montreal), Alexander Rehding (Harvard University), Katelijne Schiltz (Universität Regensburg) und Stefan Weinzierl (TU Berlin).
Link zum Jahrbuch
https://simjb.journals.qucosa.de/simjb/