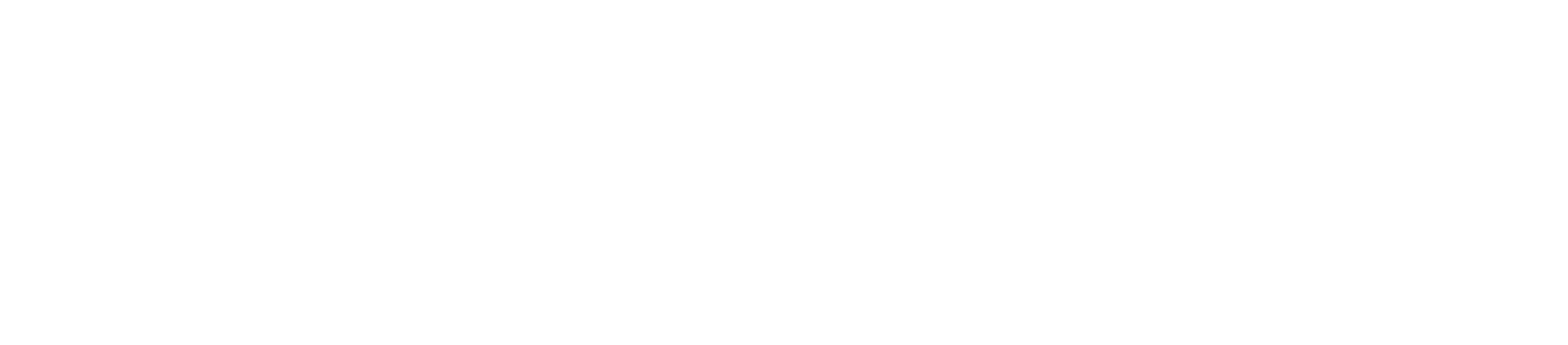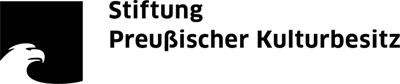Bereichsnavigation
Museumsklima:
Risiken und Nebenwirkungen
Info
Der Artikel basiert auf dem Impulsvortrag Museumsklima: heute wie damals?, vorgetragen am 15.6.2023 im Diskussionspanel Energiekrise und der Umgang damit - Spannungsfeld Energie und Bestandserhaltung im Rahmen des Arbeitstreffen der Notfallverbünde 2023 Better safe than sorry - Grundlagen und Erfahrungsaustausch vom 15. bis 16.6.2023 in Berlin.
Die Entwicklung von Klimastandards in Museen und ihre Folgen für Kulturgüter
Als im Jahr 2022 im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine die erste Alarmstufe des "Notfallplans Gas" der Bundesregierung ausgerufen wurde, läuteten auch in den Museen die Alarmglocken. Gehören die Einrichtungen zur kritischen Infrastruktur und werden auch in Mangellagen mit Energie versorgt? Museumsdirketorinnen versuchten, die Aufmerksamkeit der Politik auf ihre Forderungen und Bedarfe zu lenken. Dabei geisterten zwei Werte durch die Medien: 50% relative Luftfeuchtigkeit +/- 5% und 20°C Raumtemperatur.
Diese Werte sind in der Welt der Museen und Archive omnipresent. Sie werden viel zitiert und noch mehr diskutiert. Sie sind einer der Hauptgründe für den hohen Energiebedarf dieser Einrichtungen. Gleichzeitig ist ihre wissenschaftliche Grundlage nicht so unangefochten, wie es zunächst scheint. In diesem Artikel möche ich daher der Entstehung dieser Werte nachgehen, ihre Vorteile aber auch ihre Risiken für unser Kultugut aufzeigen.
1. Von Zentralheizungen, U-Bahnhöfen und Schiefermienen
In einer Ausgabe der Zeitschrift für Instrumentenbau aus dem Jahr 1912 findet sich der Abdruck einer Rede des Abgeordneten Stosser vor dem Preußischen Kulturrat. Er erzählt von der Sammlung alter Musikinstrumente an der Königlichen akademischen Hochschule in Berlin, heute Musikinstrumenten-Museum des Staatlichen Instituts für Musikforschung, und dem schrecklichen Zustand der Instrumente.

„Die Instrumente sind fast samt und sonders in schwerer Weise beschädigt. Im Winter zerspringen sie vor Kälte und im Sommer vor Wärme. Die Instrumente, die sich unten befinden, werden durch die Zentralheizung beschädigt, welche die Musikinstrumente ganz und gar nicht vertragen. Wenn Sie diese wertvolle und schöne Sammlung ansehen, bitte ich darauf zu achten, daß sich unter den 3000 Instrumenten kaum ein einziges befindet, das nicht gesprungen ist. Es ist keine Übertreibung, wenn ich behaupte, daß in 5 Jahren die ganze Sammlung ruiniert ist, wenn das so weitergeht."
—Abgenordneter Stosser, zitiert nach: Zeitschrift für Instrumentenbau, Band 33, S. 851
Zum Glück wurde die Vision des Herrn Stosser nicht Wirklichkeit, aber ob nach seiner Rede Maßnahmen unternommen wurden, ist nicht überliefert.
Andere Museen weltweit hatten auch schon im späten 19. Jahrhundert ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Die Zentralheizungen, welche vor allem für den Komfort der Besucherinnen eingebaut worden waren, führte zu massiven Schäden, besonders bei Gemälden. Die Alte Pinakothek in München stellt ihre Zentralheizung daraufhin kurzerhand ab. Dies führte im Winter zu Minusgraden in den Galerien und zur Schimmelbildung an den Gemälden. Man beschloss daher eine Heizung einzubauen, mit der man die Galerien kontrolliert befeuchten konnte. Schon damals stand der Zielwert von ca. 50% relativer Luftfeuchtigkeit im Raum.
Exkurs relative Luftfeuchtigkeit
Luft kann Wasserdampf aufnehmen. Je höher die Temperatur der Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. Die Menge an Wasser in der Luft bezeichnet man als absolute Luftfeuchtigkeit. Diese wird in Gramm pro Kubikmeter angegeben. Wie viel Wasser die Luft maximal aufnehmen kann hängt von der Termperatur ab. Bei einem "normalen" Raumklima ist die Luft aber nie vollständig gesättigt. Das Verhältnis zwischen der vorhandenen Wasserdampfmenge in der Luft und der theoretisch möglichen Wasserdampfmenge bezeichnet man als die relative Luftfeuchtigkeit. Sie wird normalerweise in Prozent angegeben.
Die relative Luftfeuchtigkeit kann Objekte auf unterschiedliche Art und Weise schädigen:
Mechanisch: Materialien wie Holz reagieren auf Änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit mit einer Änderung ihrer Größe. Sie sind hygroskopisch. Bei Schwankungen der relativen Luftfeuchte kann es dadurch zu Spannungen im Material oder, bei der Verbindung von verschiedenen Materialien, zu Spannungen zwischen den Bauteilen kommen. Dadurch können sich Objekte deformieren oder Risse entstehen.
Biologisch: Schädlinge, wie manche Holzwürmer oder auch Schimmelpilze, gedeihen besonders gut in Umgebungen mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit. Sie zerstören sehr direkt die Substanzen, aus denen historische Objekte wie Bücher, Zeichnungen und Musikinstrumente bestehen.
Chemisch: Die Präsenz von Wasser bzw. Wasserdampf beschleunigt auch chemische Abbauprozesse. So begünstigt eine hohe relative Luftfeuchtigkeit z.B. die Korrosion von Metallen.
Der Wissenschaftler Friedrich Rathgen erforschte bereits im späten 19.Jahrhundert die Risiken, die eine falsche relative Luftfeuchtigkeit vor allem für archäologische Objekte darstellt.
Im Vereinigten Königreich brauchte es eine Katastrophe, um die Forschung zum Erhalt von Kulturgütern anzuschieben. Als der erste Weltkrieg ausbrach, versuchte man die Sammlungen vor deutschen Bombenangriffen in Sicherheit zu bringen. Das British Museum entschied sich für einen stillgelegten U-Bahnhof als Lager.
Als man nach Ende des Krieges die Sammlung aus dem U-Bahnhof hervorholte, stellte sich heraus, dass die klimatischen Bedingungen alles andere als optimal gewesen waren. Korrosion, Salzausblühungen und Schimmel waren die Folge.
Das British Museum reagierte sofort und richtete ein wissenschaftliches Labor zur Untersuchung des Zerfalls von Kulturgütern ein. Der Chemiker Harold J. Plenderleith arbeitete seit 1924 in diesem Labor und schuf wichtige Grundlagen für die sogenannte präventive Konservierung. Auch die National Gallery stellte mit dem Physiker Francis I.G. Rawlins einen Naturwissenschaftler ein, der sich um den Kulturguterhalt kümmerte. Rawlins unternahm eine Reihe von Untersuchungen zur Auswirkung der relativen Luftfeuchtigkeit auf Gemälde. So betrachtete er den Feuchtegehalt von Holzproben in der Galerie über das Jahr hinweg. Das Resultat war eine durchschnittliche Holzfeuchte von 11%, was einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 bis 60% entspricht. Aber bevor die Erkenntnisse im Museum umgesetzt werden konnten, brach der Zweite Welkrieg aus.

Diesmal war man vorbereitet und die Evakuierung der Sammlungen in verschiedene Zwischenlager verlief schnell. Allerdings fand die National Gallery erst 1940 in der Manod Quarry, einer Schiefermiene, ein entgültiges Lager. In die Miene wurden Räume eingebaut, die mit einer einfachen Heizung auf die gewünschte relative Luftfeuchtigkeit heruntergetrocknet werden konnten. Der Erfolg war durchschlagend:
„Before the war, a technician was employed for some eight months out of every year […] in 1945 his visit proved a formality"
– F. I. G. Rawlins, The National Gallery in War Times
Während vor dem Krieg ein Restaurator für zirka 8 Monate im Jahr zur Behebung von Schäden eingestellt werden musste, war sein Besuch der Sammlung im Jahr 1945 nur noch eine Formalie, so Rawlins. Im Gegensatz dazu kam es bei der Rückkehr ins Museum zu einer "Epidemie" von Schäden, weshalb man sich entschied, eine Klimaanlage nachzurüsten.
Die Bedeutung dieser Anekdote ist nicht zu unterschätzen. In der Literatur zum Museumsklima der nächsten Jahrzehnte wird sie immer wieder zitiert.

2. Zweifel an der alten Weisheit
Von besonderer Bedeutung ist seit den 70er Jahren das Buch The Museum Environment von Garry Thomson. Er beschreibt die starke Tendenz vieler Museen hin zu einem stabilen Klima um 50 bzw. 55% relative Luftfeuchtigkeit. Er äußert aber auch Zweifel an der Validität der Werte, da sich diese mehr an den Fähigkeiten der Klimaanlagentechnik orientiere, als an den für die Objekte optimalen Werten. Zudem sind die Werte, die aus mitteleuropäischen Museen stammen, nicht in gleicher Weise auf Museen anderer Klimazonen übertragbar. Er schlägt daher vor, die Klimatisierung an Sammlung und Klimazone anzupassen.
Die Erkenntnisse zum Klimawandel, seinen Ursachen und Auswirkungen haben in den letzten Jahrzehnten die Diskussion um das Museumsklima von neuem entfacht. Die Frage "wie wenig Schwankung können wir erreichen?" wird immer mehr von der Frage "wie viel Schwankung können wir erlauben?" verdrängt. Mit Comuptersimulationen und hochgenauen Messtechniken können die Reaktionen von Kulturgütern auf klimatische Bedingungen untersucht und vorhergesagt werden. Manche Ergebnisse zeigen, dass Objekte auch größere Schwankungen aushalten könnten und das dabei Schäden entstehen.
Trotz der vielen Zweifel an der Sinnhaftigkeit der alten Werte halten sich diese weiterhin hartnäckig. So gab der Deutsche Museumsbund erst im Jahr 2022 – und nur als Notfallmaßnahme in Reaktion auf die Alarmstufe des "Notfallplans Gas" – neue, weitergefasste Klimaempfehlungen heraus.
3. Klimawandel und die Bedrohung der Kulturgüter
Der Klimawandel und seine Auswirkungen bedrohen unsere Kulturgüter weltweit. Im Museum denkt man dabei häufig nur an die materiellen Objekte in den Sammlungen. Der Erhalt des kulturellen Erbes der Menschheit schließt aber auch den Erhalt des immateriellen Erbes mit ein. Das International Council of Museums zählt deshab den Erhalt des immateriellen Erbes ebenfalls zu den Kernaufgaben der Museen.
"A museum is a […] institution in the service of society that […], conserves […] tangible and intangible heritage.”
– Museums Definition, International Council of Museums

Im Falle des Musikinstrumenten-Museums ist das zum Beispiel die lebendige Tradition des Instrumentenbauhandwerks. So wurde der Geigenbau in Cremona 2012 und der deutsche Orgelbau 2018 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Besonders Gewerke wie der Geigenbau sind auf natürliche Rohstoffquellen und ihre fortdauernde Qualität und Pflege angewiesen. 2017 zerstörte das Sturmtief Vaia Teile des sogenannten Bosco che suona (Klingender Wald) im Val di Fiemme, aus dem vermutlich schon Antonio Stradivari die Hölzer für seine berühmten Geigen bezog. Der Klimawandel macht das Auftreten solcher Wetterereignisse wahrscheinlicher und verstärkt ihre Intensität. Immaterielle Kulturgüter sind daher direkt bedroht.
Durch die Reduzierung der Klimatisierung der Museen wird man den Klimawandel allein nicht aufhalten können, aber die Museen sind in der Pflicht, ihren Beitrag zur Verringerung der Treibhausgase zu leisten. Keiner möchte Zustände, wie sie von Stosser beschrieben werden. Aber es geht um eine Risikoabwägung: Was können wir den Objekten zumuten? Wie stabil muss das Klima wirklich sein? Und wie ist der Erhalt der materiellen Objekte im Verhältnis zu dem des immateriellen Erbes zu sehen?
Was bringt es uns, eine Stradivari-Geige in perfektem Zustand zu erhalten, wenn andererseits Instrumentenmacherinnen nicht mehr in der Lage sind ihre Traditionen in gleicher weise fortzuführen?